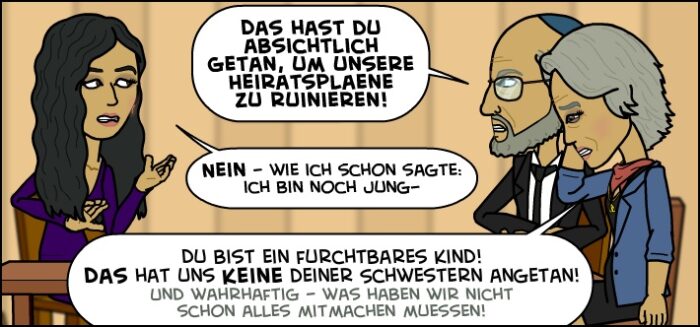Lieber Martin (Luther),
dein Lied ist nach wie vor genial; manche Liedverse finde ich unvergleichlich gut – aber im 21. Jahrhundert mitunter nur für historisch Versierte noch verständlich. Darum habe ich mich an einen Update gemacht. Sei mir nicht allzu böse!
Dein ChristianLiedtext:
Weise: Ein feste Burg ist unser Gott. Beschwingt, mit Groove und Klatschen ||
[spoiler title=’Liedtext‘ style=’default‘ collapse_link=’true‘]
Ne feste Burg ist unser Gott
mit Mauern und mit Waffen.
Er hilft uns auch aus aller Not,
die uns jetzt macht zu schaffen.
Der uralte Feind ||
der es böse meint,
mit Macht und viel List ||
er ausgerüstet ist:
So schlimm wie er ist keiner!
Mit unsrer Macht ist nichts getan,
wir sind schon bald verloren.
Es kämpft für uns der richtige Mann,
der für uns ist geboren.
Fragst du, wer der ist? ||
Er heißt Jesus Christ.
Der Herr Zebaoth: ||
Es gibt sonst keinen Gott.
Den Sieg wird er behalten.
Und wenn die Welt voll Schrecken wär
und droht uns zu verschlingen.
So fürchten wir uns nicht so sehr:
Gott wird ihn klar bezwingen.
Der Fürst dieser Welt: ||
Wie quer er sich stellt,
Er kann uns nichts tun: ||
Geschlagen ist er schon.
Ein Wort, und er muss fallen.
Das Wort von Gott bleibt immer stehn,
wenn wir fest an es glauben.
Was Gott uns gibt, wird nicht vergehn
Sein‘ Geist kann niemand rauben.
Wenn die schöne Welt ||
auseinanderfällt:
All das lass ich los, ||
ich brauch das eine bloß:
Sein Reich und seine Liebe! 💟
[/spoiler]