
Auf der diesjährigen ALPIKA Medien in Loccum kam es zu einem Treffen mit der Leiterin der Bildungsabteilung der EKD, Birgit Sendler-Koschel, bei der sehr rege über die Kundgebung der 11. Synode der EKD zum Thema Kommunikation des Evangeliums in der digitalen Gesellschaft diskutiert wurde.
Als (ein) Ergebnis dieses Gesprächs wurde festgestellt, dass zwar schon zahlreiche medienethische Auslassungen existieren, aber keine, die dezidiert theologisch begründet sind.
Daraufhin beschloss die ALPIKA Medien, der Abteilung von Frau Sendler-Koschel zuzuarbeiten, indem sie eine konzeptionelle Bestandsaufnahme zum Thema (Medien-)Ethik vornimmt.
Ich dachte mir nun: Bevor ich möglicherweise ewig auf den ersten großen Wurf eines evangelischen Theologen zu diesem Thema warte, blogge ich doch lieber selbst, was ich darüber denke.

Mir ist dabei bewusst, dass mein Ansatz nicht „Mainstream“ ist, weil ich die zB in der 1997 herausgegebenen Stellungnahme „Mediengesellschaft“ der „Gemeinsamen Texte“ der EKD und der DBK vorgenommenen anthropologischen und sonstigen Prämissen für spekulativ halte. Die Anthropologie hat in jeder Ethik ihren Platz, aber m.E. nicht in ihrer theologischen Begründung. Nichtsdestoweniger treffen insbesondere die in dieser Schrift enthaltenen Prognosen zu. Allerdings geht die aktuelle medientechnische Entwicklung weit darüber hinaus.
Nun in medias res:
1. Ethische Grundlegung
Nur Gott kennt die Wirklichkeit, wie sie wirklich ist. Auch wenn wir die Welt mit unseren Sinnen  wahrnehmen, ganz ohne mediale Vermittlung, ist das, was wir erleben, nicht die Wirklichkeit selbst, sondern eine eigene, auf Sinnesreizen basierende, individuelle Konstruktion der Wirklichkeit. Wir „sehen“ das, was wir klar zu erkennen meinen, durch einen dunkeln Zerrspiegel. Erst bei Gott erkennen wir so, wie wir erkannt sind.
wahrnehmen, ganz ohne mediale Vermittlung, ist das, was wir erleben, nicht die Wirklichkeit selbst, sondern eine eigene, auf Sinnesreizen basierende, individuelle Konstruktion der Wirklichkeit. Wir „sehen“ das, was wir klar zu erkennen meinen, durch einen dunkeln Zerrspiegel. Erst bei Gott erkennen wir so, wie wir erkannt sind.
Wenn wir die vollkommene Erkenntnis hätten, die wir bei Gott haben werden, bräuchten wir keine Religion, keinen Glauben und keinen Trost, denn wir würden schauen und wissen. Soweit sind wir aber nicht. Wir erleben Leid, Zerstörung und Tod. Oft scheitern unsere Pläne. Wir haben oft Angst. Uns bleibt als Halt nur der Glaube, der durch Zuspruch, Freundlichkeit, Rat und Gemeinschaft – Medien des Heiligen Geistes – gestärkt wird.
Daraus ergibt sich die ethische Grundaufgabe des christlichen Glaubens: Die Menschen zu trösten, sie aufzubauen und sie als Glaubende zu begleiten auf dem Weg, der vom Glauben hin zum Schauen, vom Elend des irdischen Daseins zur Auferstehung führt.
Dieser Trost geschieht essenziell durch die liebevolle Weitergabe der Botschaft von Gottes Liebe, und in besonders kraftvoller Form durch die Sakramente als Zeichen der unbegrenzten Verbundenheit mit Gott.
NB: Dies alles kann weitgehend unabhängig davon geschehen, welches Weltbild oder Bild vom Menschen gerade en vogue ist. Jesus hat niemals jemanden gefragt, welche Weltanschauung er bzw sie besitzt.
2. Welcher Einsatz digitaler Medien ist ok?
Im allgemeinen übertrifft nichts die unvermittelte Weitergabe von Gottes Liebe, welche sich in der persönlichen Begegnung ereignet.
Allerdings bediente sich die Christenheit schon früh vermittelter Kommunikationsmöglichkeiten (Medien), welche eine größere Breitenwirkung erzielten: Lieder, Briefe, vervielfältigte Schriften; später Bücher, Grafiken und Bilder. Dabei entstanden zT Werke von epochemachener Wirkung und enormer, nachhaltiger Kraft.
Nicht immer wurden diese als Werkzeug zur Weitergabe der Botschaft von Gottes Liebe eingesetzt. Der Medienmissbrauch begann schon in den ersten beiden Jahrhunderten mit dem Verfassen von unechten apostolischen Schriften zum Zweck der Durchsetzung bestimmter Lehrmeinungen. Später kamen demagogische und diskriminierende Schriften oder Karikaturen hinzu.
Nichtsdestoweniger haben Apologien und Abgrenzungsschriften ihren Platz. Zur Weitergabe von Gottes Liebe gehört es, Abwege kenntlich zu machen, die zu nichts führen. Leicht kann es glaubenden Medienproduzenten geschehen, dass sie dabei über das Ziel hinausschießen und der Sache Gottes schaden.
Die Grundfrage bei jeglicher Medienerstellung lautet:
Ist dieses Medium geeignet, zu trösten, Rat zu geben, Liebe und Gemeinschaft zu stärken, ein Leben im Heiligen Geist voranzubringen?
Diese Frage muss in sehr zurückhaltender Form beantwortet werden, denn so verschieden die Menschen sind, so verschieden kann das ausfallen, was ihnen wirklichen Trost spendet. Es gibt Starke und Schwache im Glauben. Manche finden Trost in einer gesteigerten, ethischen Verbindlichkeit, andere sehnen sich nach Freiheit.
 Auch ein Aspirin kann trösten. Rosamunde-Pilcher-Filme sind trotz ihres Placebo-Charakters für viele bessere Seelenarzeneien als tiefgründige, aber schwer verständliche Predigten. Insofern können manche mediale Seelenarzeneien an einer Stelle hilfreich sein, die woanders Anstoß erregen.
Auch ein Aspirin kann trösten. Rosamunde-Pilcher-Filme sind trotz ihres Placebo-Charakters für viele bessere Seelenarzeneien als tiefgründige, aber schwer verständliche Predigten. Insofern können manche mediale Seelenarzeneien an einer Stelle hilfreich sein, die woanders Anstoß erregen.
Kurzum: Die Grenze zwischen geistlicher Förderlichkeit oder Schädlichkeit eines Mediums verläuft nicht gradlinig und nicht immer dort, wo in der Zivilgesellschaft die Grenze des guten Geschmacks, des Anstands oder der Legalität liegen.
3. Mögliche Konkretisierung
Jede weitere Konkretisierung einer Medienethik orientiert sich an anthropologischen Vorgaben. An dieser Stelle kommen unterschiedliche Lehrmeinungen ins Spiel, die sich ethisch Handelnde abhängig von ihrer Weltanschauung aneignen. Ich kann hier nur meine Meinung skizzieren, ohne Anspruch auf ultimative Evidenz:
Ich gehe davon aus, dass Gott den Menschen so will, wie er ihn erschaffen hat. Eine christliche Ethik schadet darum einem Menschen, wenn dieser suggeriert bekommt, dass er aus sich einen anderen Menschen machen müsse. Im Gegenteil: Die Aufruf Jesu zur Umkehr, die jedem Glauben zugrunde liegt, hat zur Folge, dass der umgekehrte und glaubende Mensch weniger von sich selbst entfremdet ist als zuvor.
Zugleich kann ihn der Glaube von dem Zwang befreien, dieses und jenes erreichen zu müssen, um wahrhaft er selbst zu sein, was ohnehin ein sinnloses Unterfangen wäre: Nicht der Mensch verwirklicht sich selbst, sondern Gott verwirklicht den Menschen.
In diesem Sinne sollte der Einsatz von Medien die Authenzität der Menschen stärken und heilend auf sie wirken,
- indem sie sie bestärkt, Fremdem und Fremden wertschätzend zu begegnen,
- indem man ihnen eigene Verantwortung zutraut und zugesteht,
- indem man sie ermutigt, sich nicht selbst zu verleugnen, sondern aufrichtig und authentisch zu handeln,
- indem man sie dazu anreizt, aufgeschlossen und frei auf andere zuzugehen und eigene Kreativität zu entfalten,
- indem man sie ermuntert, denjenigen, die ihnen am Herzen liegen, mit Empahtie, Liebe und Hilfsbereitschaft zu begegnen,
- und schließlich, indem man sie fit macht, Probleme unparteiisch und gerecht zu beurteilen und sich in der eigenen Einschätzung nicht von anderen manipulieren zu lassen.
Das wäre es dann auch schon.
Der unten folgende, vierte Teil ist ein Anhang, welcher sich mit speziellen Eigenheiten und Problemzonen der Digitalmediendidaktik befasst und versucht, sie im Licht der oben genannten Grundsätze zu betrachten.
4. Die Einwirkung neuer Medien auf den Menschen
Heute, im Jahr 2015, nehmen die Medien eine nie gekannte Bedeutung für die meisten Menschen ein. Unser Leben wird von morgens bis abends von Medienkonsum und Medieneinsatz gesteuert. Daraus erwächst ein Herrschaftscharakter digitaler Medien, welcher die conditio humana beeinflusst, vom Aufbau virtueller Identitäten bis hin zum Identitätsdiebstahl und dem perfekten Rufmord.
Dieser Herrschaftscharakter äußert sich in zweierlei Weise, die in einer christlichen Medienethik thematisiert werden müssen (und auch im Schlusskapitel der oben erwähnten Denkschrift angesprochen wurden):
4.1 Der suggestive Charakter digitaler Medien
Durch eine immer weiter perfektionierte Darstellungstechnik gelingt es, Positionspapieren einen ungeahnten Wahrheitsanspruch zu verleihen.
Dies beginnt schon bei ganz alltäglichen Vortragsveranstaltungen. Wo man früher Referate hielt, die anschließend einer offenen Kritik unterzogen wurden, kann heute ein geschickter Präsentator seine Inhalte dermaßen perfekt medial verpacken, dass die weniger kritische Mehrheit der Zuschauer die Botschaft als gegeben und wahr „frisst“, während sich der kritische Teil des Publikums auf medientheoretischen bzw medienethischen Nebenkriegsschauplätzen aufreibt.
Ein ähnlicher Effekt kommt der asynchronen Kommunikation von Online-Veranstaltungen zu: Vorträge werden nicht live gehalten, sondern sind als Videovortrag konserviert und von vornherein „gegeben“. Eine direkte, kritische Replik ist nicht möglich.
Wo früher ein Diskurs angebahnt wurde, werden heute Wahrheiten verkündigt.
Diese Entwicklung leistet einem weitverbreiteten, schleichenden Dogmatismus (in allen Bildungsbereichen) Vorschub.
Abgesehen von dieser ideologiekritischen Paränese ist festzustellen, dass die Möglichkeit der Herstellung suggestiver, bestechender, praxis-simulierender und zu offenem Lernen anstoßender Unterrichtsmaterialien zumindest in Deutschland viel zu wenig genutzt wird. Während sich die Schüler in ihrem Alltag den im Netz verbreiteten, guten oder bösen Mems willig aussetzen und sie weiterposten, kommt an den Schulen der Übergang von der altvorderen Analogpädagogik, die ihre Wurzeln im Spätmittelalter hat, zu einer der digitalen Medienwelt angepassten Didaktik nur im Schneckentempo voran.
Im Fach Religion sieht es am traurigsten aus: Dort besteht nicht nur ein hermeneutisches Problem („Wie nutze ich digitale Medien, um die Botschaft von Gottes Liebe zu vermitteln?“), sondern dazu noch ein grundlegenderes, theologisches: Geht die digitale Vermittlung, bei der alles und jedes in möglichst plastische Bilder übersetzt wird, nicht in die falsche Richtung, da wir uns im Glauben doch eigentlich von im Hirn festgebackenen Vorstellungen lösen sollen, weil alles andere im oben erwähnten Dogmatismus und also im Götzendienst endet?
Es sind tatsächlich die fundamentalistischen Gruppierungen, welche sich um dieses Problem am wenigsten scheren, die zZ die eindrücklichsten, religionspädagogischen Digitalmedien veröffentlichen, etwa die Mormonen, die Zeugen Jehovas und ähnliche.
httpvh://www.youtube.com/watch?v=unANW0P-O9M
Doch auch wenn man gelegentlich auf deren Material zurückgreifen kann, sollte man sich ihre Medienethik nicht aneignen, sondern möglichst bald eine Art Leitfaden entwickeln, wie sich sich ein „evangeliumserhaltender“, religionspädagogischer Digitalmedieneinsatz realisieren lässt.
Das Web 2./3.0 ermöglicht es, virtuelle Identitäten zu erschaffen oder zu fälschen
Der durch die Medien schon seit Jahrzehnten aufgebaute Perfektionsdruck in Sachen Schönheit, Fitness und sonstiger Selbstvervollkommnung kostet die Menschen eine Menge Aufwand und Kraft. Soziale Communities wie Facebook verschaffen jedoch vielen Menschen eine Entlastung, indem sie den Vorsichtigeren unter ihnen die Möglichkeit geben, sich digital aufzuhübschen oder sonst irgendwie vorteilhaft darzustellen – bis hin zur völlig erfundenen, künstlichen Identität. Wer in dieses Spiel richtig passioniert einsteigt, dem stellt sich irgendwann die Frage: Wo eigentlich findet mein wahres Leben statt? In der schäbigen Realität, in der ich mein Überleben sichern muss, oder in Community-Hausen?
Jesu Wort „Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen“ wird von diesen Leuten quasi im Kurzschluss über die sozialen Netzwerke realisiert.
Diese eskapistischen Lebensstrategien von vornherein moralisch zu verdammen wäre, glaube ich, nicht im Sinne des oben angedeuteten theologisch begründeten Grundsatzes digitaler Medienethik, jedes Medium einzusetzen, das geeignet ist zu trösten, Rat zu geben, Liebe und Gemeinschaft zu stärken, ein Leben im Heiligen Geist voranzubringen.
Sollte man etwa Behinderte wieder in die Unannehmlichkeiten des vordigitalen Zeitalters zurückkatapultierten, wo ihnen doch diverse Augmentationstechnologien inzwischen zu einer nahezu perfekten virtuellen Existenz verhelfen? Und wenn man diese Freiheiten Behinderten zugesteht, warum sollte man sie Nichtbehinderten verweigern?
Damit sollen betrügerische Identitätsfakes oder gestohlene Identitäten nicht gerechtfertigt werden. Wer digitale Techniken dazu gebraucht, anderen Menschen Leid oder Schaden zuzufügen, praktiziert keine christliche Ethik.
Scanner- und AI-Technologien ermöglichen es, unechte Beziehungswelten zu erzeugen
Wer sich an seinem Smartphone mit Siri oder einem anderen digitalen Assistenten unterhält, erfährt am eigenen Leibe, wie weit Spracherkennungssysteme und künstliche Intelligenz mittlerweile fortentwickelt wurden. Zwar ist die derzeitige AI, auch wenn die fortgeschritterenen Software-Bots mittlerweile den Turing-Test bestehen würden, nich nicht wirklich intelligent (indem etwa Sprache tatschächlich nach Bedeutung entschlüsselt und verstanden wird), doch an dieser Stelle forschen die wichtigsten Softwarekonzerne derzeit mit Hochdruck und Milliardenbudgets.
In naher Zukunft wird es also möglich sein, nicht funktionierende Sozialcommunities durch völlig künstliche Beziehungspartner zu ersetzen und wohl auch nach dem eigenen Gusto zu gestalten.
Nun widerspricht der oben formulierte Grundsatz, dass sich die Weitergabe der Botschaft von der Liebe Gottes idealer Weise in einer unvermittelten persönlichen Beziehung ereignet, nicht ohne Grund dem unkontrollierten Aufbau artifizieller Beziehungswellen.
Doch im Zuge kirchlicher Personaleinsparungen stellt sich schon die Frage, ob nicht manche Dienstleistungen, für die heuer noch Mitarbeiter kostspielig bezahlt werden müssen, in Zukunft per Onlineservice mit Hilfe von Dienstleistungsbots erledigt werden.
Man muss ja nicht gleich einen Verkündigungs-Homunculus oder einen elektrischen Mönch generieren.
Spielewelten lassen Menschen in Kunstwelten abtauchen und machen süchtig
Beim Thema „Computerspielsucht“, „Internetsucht“, „Internetpornosucht“ o.ä. schlagen die Wellen besonders hoch. Tatsache ist: Genauso wie man alkoholsüchtig, nikotinsüchtig, drogensüchtig, putzsüchtig, arbeitssüchtig ( was streng genommen eine Abhängigkeit vom eigenen Adrenalinausstoß ist) und dergleichen werden kann, so stellen auch digitale Medien eine ganze Palette an Suchtquellen zur Verfügung.
Zentralproblem bei allen diesen Erscheinungen ist der Realitätsverlust, bzw die Flucht aus dem wirklichen Leben – wobei sich die Frage stellt, ob unser heutiger, analoger Realitätsbegriff im Sinne von Verbundenheit mit dem physikalischen und biologischen Dasein rund um uns herum in den Augen zukünftiger Generationen noch aufrecht erhalten werden kann.
Anstelle einer Symptomschilderung verweise ich auf diesen Artikel und auf den untenstehenden Video:
httpvh://www.youtube.com/watch?v=khszIH0bbos
So sehr es vielleicht zu begrüßen ist, dass Computerspiele für uns überzivilisierte und reglementierte Kulturwesen Ventile für verkümmernde, archaische Sehnsüchte schaffen (zu kämpfen, zu jagen, zu töten, Gemeinschaft in tödlicher Gefahr zu erleben, sexuelle Phantasien auszuleben, ohne dabei jemandem zu nahe zu treten, Beziehungs-Versuchsballons zu testen, die man im realen Leben niemals steigen lassen würde, etc.): Passionierte Medienkonsumenten erleben diese synthetisch vorbereiteten Kompensationserfahrungen als immanente, glücksspendende Ersatz-Erlösung. Es bedarf wohl einer speziellen Hermeneutik, um Menschen mit solchen Synthetikerfahrungen für „die“ Erlösung® zu gewinnen.
Diese Konkurrenz in Sachen Erlösung kann man durchaus als einen weiteren Schlag gegen die verloren gegangene, christliche Deutungshoheit bewerten, nachdem schon seit Jahren Fernseh- und Rundfungmeldungen von vielen Leuten als Quelle sowohl von Unterhaltung als auch von normativer Erkenntnis („Wissenschaftler haben festgestellt“) angesehen werden – was früher der Sonntagspredigt oder dem Konfirmandenunterricht vorbehalten war. Die Kirche wird in diesem Zusammenhang nicht einmal mehr als Mitspieler wahrgenommen. Ihre Marginalisierung ist in der Mediengesellschaft erheblich weiter fortgeschritten, als es die meisten Kirchenoberen wahr haben wollen.
4.2 Der klammheimliche Allmachtsanspruch digitaler Kommunikationsmittel
Verfügbarkeit von Information
Der von Medienpädagogen stets hervorgehobene Pluspunkt der digitalen Kommunikationsmittel, die allgegenwärtige Verfügbarkeit von Wissensressourcen, revolutioniert in der Tat die pädagogische Welt. Hinzu kommen neben den vielen Informationsquellen auch didaktische und methodische Hilfen wie zB Learning Management Systeme (Moodle, Edmodo, Canvas, usf), Onlinekurse, Bibliotheks– und Medienportale, usw.
Doch diese Werkzeugfülle fiel weder vom Himmel, noch ist sie eine Selbstverständlichkeit. Alles, was ins Netz gestellt wurde, kostete Arbeit, Zeit und oft auch Geld. ![By ISKME (OER Commons, a project created by ISKME) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Logo_OER.png) Kann man das als endverbrauchender Pädagoge oder Schüler umsonst bekommen? Darum dreht sich die derzeit stattfindende OER-Debatte.
Kann man das als endverbrauchender Pädagoge oder Schüler umsonst bekommen? Darum dreht sich die derzeit stattfindende OER-Debatte.
Mittlwerweile werden immer mehr Schulen mit digital kompatiblen Werkzeugen (zB Whiteboards, Tablets) ausgerüstet, damit der Unterricht die Vorteile der digitalen Medien nutzen kann. Bei diesen Werkzeugen ist sehr darauf zu achten, welche Form des Unterrichts sie begünstigen. Whiteboards zB – als Weiterentwicklung der Tafel -, könnten den kompetenzorientierten Unterricht, welcher auf Diskursivität, Offenheit und Praxisbezogenheit setzt, zurück in ein lehrer- bzw referentenbezogenes Zeitalter zurückwerfen. Hier müssen gerade auch für das Fach Religion Methoden gefunden werden, die die sinnvollen Ansätze eines kompetenzorientierten Unterrichts mit denen digitaler Medien kombinieren.
Handys und Smartphones verändern das Sozialverhalten (in erster Linie von Jugendlichen)
Seit der Erfindung des Telefons ermöglichen mediale Hilfsmittel nicht nur eine vermittelte Kommunikation – sie ermöglichen darüber hinaus die Kommunikation von Menschen, die räumlich – und inzwischen auch zeitlich – voneinander getrennt sind (zB via Mail, SMS und entsprechende Dienste). Durch Mobilgeräte, Smartphones und Tablets lassen sich aus dem Stand fast unbegrenzt Kontakte herstellen, Informationen sammeln bzw. versenden. Oder Spiele daddeln.
Speziell die Verbindung mit sozialen Netzwerken steigert dieses Potential weiter: Während eines (Audo- oder Video-)Ferngespräches lassen sich Mitschnitte oder Bilder machen, Vorschläge direkt umsetzen, räumlich nicht anwesende Gesprächspartner hinzuziehen, Dokumente gemeinsam mit Leuten bearbeiten, die sich Tausende Kilometer weit entfernt befinden. Jenseits der „analog“ wahrgenommenen Wirklichkeit tut sich eine zweite, noch viel weiter reichendere auf.

Viele Jugendliche zücken darum bei jeder sich bietenden Gelegenheit ihr Smartphone und tauchen ab in die jeweilige, von den Mobilgeräten vermittelte, virtuelle Welt. Diese Beschäftigung ist mittlerweile Standard an Bushaltestellen, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder Wartezimmern. Doch auch in der Gesellschaft anderer Menschen wird häufig dem sich meldenden Smartphone Priorität vor den echten Gesprächspartnern eingeräumt, was auf Altvordere wie eine Verkrüppelung des Beziehungslebens wirkt und bei Jugendlichen tatsächlich auch zu einer Abnahme an realweltlichen Beziehungen geführt hat. Hinzu kommen gelegentliche, leidvolle Erfahrungen, wenn zB jemand, der mit seinem Smartphone unterwegs ist, versehentlich gegen eine Laterne prallt oder im Auto infolge der intensiven Beschäftigung mit einem Mobilgerät einen Unfall mt Todesfolge verursacht.
Man kann über diesen Trend klagen, wird ihn aber wohl kaum noch stoppen können. Es gilt, die sozialen Netzwerker dort anzusprechen, wo sie sich für gewöhnlich aufhalten.
Die Macht der Profile
In der oben erwähnten Veröffentlichung „Mediengesellschaft“ aus dem Jahr 1997 wurde ein wichtiges Prinzip vertreten: Die Medien hätten eine dienende Funktion; und nur in dieser Rolle seien sie hinnehmbar.
[iframe src=“https://www.flickr.com/photos/edwinylee/7954318250/player/“ width=“200″ height=“200″ frameborder=“8″ allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen align=“right“]Inzwischen sieht die Welt anders aus: Fast jede Website, jede App wertet ihr Nutzerverhalten aus, und große Konzerne (die in der oben erwähnten Schrift als „Machtoligopole“ bezeichnet wurden) haben von all ihren zT Milliarden Nutzern, aber auch von Nichtnutzern, über die sie indirekte Informationen erhalten, Personencharakteristiken erstellt. Google beispielsweise legt Bewegungsprofile seiner Nutzer an, und wenn ein laut Einwahlverhalten sich in Europa aufhaltendes Mitglied plötzlich in Asien seine Mails abruft, versendet Google einen Warnhinweis an das Mitglied, dass sein Email-Konto wahrscheinlich gehackt wurde.
Man kann diese „wissende“ Fürsorge, selbst wenn sie lediglich durch Algorithmen und Automatismen erledigt wird, toll finden. Oder man kann sich durch sie bedroht fühlen: Denn die besagten Oligopole fragen den profiltechnisch Erfassten nicht um Erlaubnis. Er besitzt, ob es ihm gefällt oder nicht, Avatare von sich in seiner Bank, bei seinem Internetprovider, bei den sozialen Netzwerkbetreibern und an vielen anderen Stellen – nicht zuletzt bei unterschiedlichen Geheimdiensten.
Dieses dort vorrätige Wissen kann den real existierenden Menschen durchaus bedrohen und im Extremfall vernichten. Besonders tragisch wird es, wenn man gemobbt wird und gezielt rufschädigende oder falsche Informationen weitergeleitet werden. Während man selbst ein harmloser Zeitgenosse ist, hat sich der eigene Avatar bei Ämtern und Finanzinstituten in ein Monster verwandelt, ohne dass der Betroffene etwas davon weiß.
Natürlich berührt diese heimliche Herrschaftsfunktion des digitalen Medieneinsatzes gewisse Persönlichkeitsrechte, und die Bundesrepublik Deutschland kämpfte einen heroischen, mitunter unfreiwillig peinlichen Kampf gegen die britischen und amerikanischen Ausspähorganisationen – leider erfolglos.
Die dienende Funktion digitaler Medien gehört der Vergangenheit an.
Jammern hilft nicht – wir müssen uns fragen, wie man theologisch und praktisch damit umgeht.
An einem Beispiel wil ich dies illustrieren:
Internet-Mobbing
Die traditionelle Sichtweise von moralischer Integrität stellt sich nach meiner Erfahrung so dar: Ein Mensch hält sich in der Öffentlichkeit an Gesetze, Moral- und Anstandsregeln. Was er oder sie im Privatleben treibt, ist seine Sache. Entscheidend ist, dass er niemandem dabei schadet. Neben dem rein privaten Bereich gibt es einzelne Gelegenheiten – Feste, närrische Zeiten -, bei denen Entgleisungen gnädiger behandelt werden als sonst.
![]() Richtig schlimm wird es, wenn unziemliche Bild- oder Tonzeugnisse aus der vermeintlichen Privatsphäre in die Öffentlichkeit gelangen. Das kann so manches Leben sehr zu seinem Nachteil verändern.
Richtig schlimm wird es, wenn unziemliche Bild- oder Tonzeugnisse aus der vermeintlichen Privatsphäre in die Öffentlichkeit gelangen. Das kann so manches Leben sehr zu seinem Nachteil verändern.
Durch den Einsatz digitäler Medien ist eine klare Trennung von Privat- und öffentlicher Sphäre nicht mehr haltbar. Man kann theoretisch überall beobachtet, abgelichtet, verfolgt, abgehört werden. Es genügt, wenn ein Bekannter XY ein Partyphoto bei Facebook postet, auf dem irgendwo im Hintergrund eine Peinlichkeit zu sehen ist. Durch den algorithmengesteuerten Gesichtsscanner wird der Verursacher dieser Peinlichkeit identifiziert – und schon steht etwa ein wichtiges Bewerbungsgespräch unter einem ganz schlechten Stern.
Da man die digitalen Erzeugnisse nicht wieder aus dem Netz entfernen kann, muss sich an ihrer Beweiskraft etwas ändern. Hier hilft ein theologischer Ansatz: Während in der bürgerlichen Gesellschaft eine oft sehr heuchlerische Fiktion von Anständigkeit aufrecht erhalten wird, ist nach christlicher Lehre jeder Mensch ein Sünder. Ein inkriminierendes, digitales Beweisstück sagt zwar grundsätzlich etwas aus über den Dargestellten, aber es könnte im Prinzip jedem passieren.
Von daher sollte es Aufgabe der Kirchen sein, auf die Zivilgesellschaft einzuwirken, dass Menschen guten Willens nicht stigmatisiert, sondern zukunftszugewandt und wertschätzend behandelt werden. Das biblische Rollenvorbild für solche Kirchenvertreter finden wir übrigens in Paulus beim Verfassen des Philemonbriefes, der sich in ganz erstaunlicher Weise für den entlaufenen Sklaven Onesimos bei dessen zum Christentum bekehrten Besitzer einsetzte.
Digitale Medien – der Königsweg zukünftiger Glaubensverkündigung?
Ich habe meine Zweifel, dass die digitalen Medien von der Christenheit in ähnlicher Weise wie die handschriftlichen Medien der ersten nachchristlichen Jahrhunderte oder die Printmedien der Reformationszeit zur Verbreitung des Glaubens eingesetzt werden können, denn ihre Stärke liegt in dem Potential, dass Menschen zu Schöpfern ihrer eigenen Kunstwelt werden können – sei es durch ein Netzwerk von virtuellen Sozialkontakten, sei es durch Spielewelten oder künstliche Identitäten. Und je perfekter diese Gedankenblasen ausfallen, desto partikulärer entwickeln sich die dort geltenden Regeln und Ethiken. Kann jemand, der von morgens bis nachts auf virtuellen Schlachtfeldern massenweise Feinde umbringt, ein wirklich normales Leben in einer Zivilgesellschaft führen?
Eine denkbar erfolgreiche Nutzung religionspädagogischer Digitalmedien endet letztlich im Aufbau einer weiteren, attraktiven Kunstwelt, auch wenn wir Theologen sagen würden: „Nein, dies ist keine weitere Kunstwelt, sondern das von uns verkündigte, dunkle Spiegelbild der göttlichen Wahrheit.“
Wie soll ein Medienkonsument den Unterschied zwischen Fake und echt treffen können?
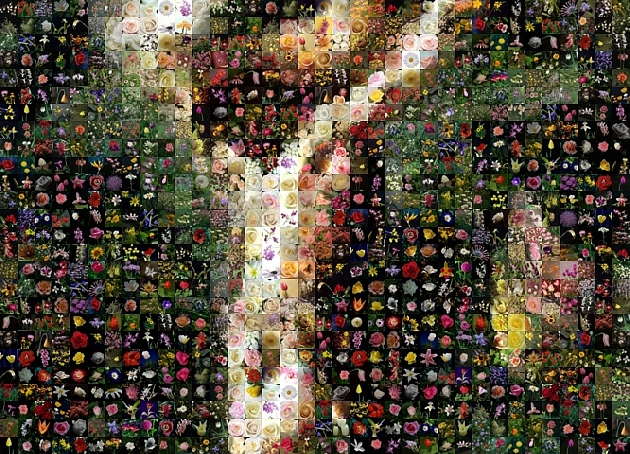
Ich denke: Ein christliches, durch digitale Medien dargestelltes Welt-Bild kann seinen Vorrang vor artifiziellen Medienkonstrukten nur dadurch unter Beweis stellen, dass es den Medienkonsumenten zurück in die digital unvermittelte Wirklichkeit (die mit den Problemen, welche man sich nicht aussucht) führt. Denn nur hier – auf dem steinigen Boden der Realität – steht die Himmelsleiter, über die Gottes Liebe die Seinen zu sich führt.


